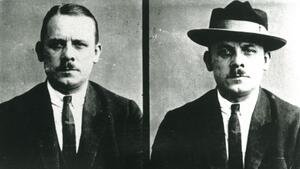Der Hass kommt per Textnachricht. Bis zu 70 am Tag, über den Zeitraum von etwa zwei Jahren. Was eine Gruppe Jugendlicher in den USA erlebt hat, ist schwer vorstellbar. Noch beklemmender ist die Tatsache, wer letztlich hinter den Nachrichten steckt. Die neue Netflix-True-Crime-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" verstört viele Zuschauerinnen und Zuschauer – der schockierender Plot Twist ist nur einer der Gründe dafür.
Spoilerwarnung: Wer "Unbekannte Nummer" auf Netflix nicht gesehen hat, wird in diesem Text erfahren, was hinter dem Fall steckt.
Als die erste Nachricht einer unbekannten Nummer im Jahr 2020 auf ihrem Handy erscheint, ist Lauryn gerade einmal dreizehn Jahre alt. Damals weiß die Schülerin aus einem verschlafenen Örtchen im US-Bundesstaat Michigan noch nicht, dass auf diese Nachricht tausende weitere folgen werden und die ganze Welt einmal darüber urteilen wird.
Nichts an Lauryns Leben scheint auf den ersten Blick außergewöhnlich: Lauryn geht zur Schule, spielt gerne Basketball, macht Leichtathletik und ist schon seit mehreren Monaten mit ihrer Sandkastenliebe Owen X. zusammen. In ihrem Alter eine kleine Ewigkeit.
Nichts an ihrem Leben scheint außergewöhnlich bis zu dem Tag im Oktober, als folgende Worte auf ihrem Handydisplay aufploppen: "Er wird mit dir Schluss machen."
Es wird Tage geben, an denen Lauryn bis zu 60 Nachrichten von dieser unbekannten Nummer erhalten wird: Beschimpfungen, Obszönes. Texte darüber, dass sie nichts wert sei und ihr Freund etwas Besseres verdient habe. Dass man sie fertig mache würde, dass ihr Körper, ihre sportlichen Leistungen, dass sie nicht gut genug sei.
Es scheint so, als wolle die Person, die hinter den Hassnachrichten steckt, die Beziehung der Teenager zerstören. Letztlich gelingt ihr das auch. Der Druck, das Misstrauen, die Angst, Wut und Ohnmacht übermannen Lauryn und Owen, nach einigen Monaten trennen sich die beiden. Der Terror wird noch schlimmer. Die fremde Person schreibt Lauryn immer wieder, sie sei wertlos und solle sich umbringen.
Wer ist dazu imstande, über Monate hinweg, teilweise stundenlang am Tag anderen Menschen solche Nachrichten zu schreiben? Diese Frage beschäftigt bald einen ganzen Ort. Etwa die Eltern der Teenager, allen voran Owens Mutter Jyll und Lauryns Mutter Kendra, aber auch die anderen Schüler der Highschool, ihren Rektor und den Sheriff. Er ermittelt im Umfeld der Schüler: Wer kennt Lauryn gut genug, um ihren Spitznamen Lo zu kennen? Wer weiß, was sie und ihre Mitschüler im Unterricht besprechen?
Wie bei Cluedo – nur mit traumatisierten Teenagern
In der Doku kommen mehrere von ihnen zu Wort – und werden immer wieder als mögliche Verdächtige präsentiert: Khloe, eine Freundin von Owen, die anderen Schülern zufolge eifersüchtig gewesen sein könnte und der in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, gemeinsam mit ihren Freundinnen eine Schülerin namens Adrianna zu mobben. Auch Adrianna kommt zu Wort. Hat sie möglicherweise versucht, Khloe als Rache etwas anzuhängen? Es ist ein munteres Wer-hat’s-getan-und-warum? Ein bisschen wie im Brettspielklassiker Cludeo – nur mit traumatisierten Teenagern.
Letztliche braucht es einen FBI-IT-Spezialisten, um den Fall aufzuklären. Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei Internet- und Appanbietern sind nötig, um herauszufinden, wer hinter den Nachrichten steckt. Die Antwort auf diese Frage schockiert gerade Netflix-Zuschauerinnen auf der ganzen Welt.
Der verstörende Moment, auf den alles ausgerichtet ist
Es ist Kendra, Lauryns eigene Mutter. Die Frau, deren Interview in der Netflix-Doku zu geschnitten ist, dass sie eingangs davon spricht, wie ihre Tochter immer weiter verzweifelt. Die Frau, die das Basketballteam in der Schule leitet und dort fast täglich anzutreffen ist, die sich beim Sheriff nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erkundigt. Die Dokumentation ist um diesen Höhepunkt, diesen verstörenden What-the-fuck-Moment aufgebaut.
Zuerst werden den Zuschauern allerdings viele der anderen Protagonisten als mögliche Täter präsentiert. Da werden ganz einfache Narrative bedient: Khloe wird als das beliebte "Mean Girl" der Schule präsentiert, an einer Stelle rückt die Doku auch Lauryn selbst, die tausende Hassnachrichten erhalten hat, in den Fokus – als eine Art stille Außenseiterin, die ja vielleicht einfach nur die Aufmerksamkeit genießt, die die Hassnachrichten mit sich bringen.
Es mag aus dramaturgischer Sicht fesselnd sein, mitzuraten und nicht zu wissen, wer letztlich hinter den Nachrichten steckt, aus ethischer Perspektive ist problematisch.
Fast noch verstörender als der Plot Twist
Denn was viele Menschen vergessen zu scheinen: Da sitzen echte Menschen vor einer Kamera und sprechen von den schrecklichsten Erfahrungen ihres Lebens. Sie werden einem Millionenpublikum als Täter und mögliche Bullys präsentiert, vermutlich, ohne wirklich die Konsequenzen der Dokumentation einschätzen zu können. Weil sich die Geschichte so besser verkaufen lässt – mit einfachen Narrativen und Informationen, die peu à peu präsentiert werden.
Da werden sogar die Bodycam-Aufnahmen des Sherriffs in der Doku auch den Moment zeigen, in dem Lauryn und ihr Vater Shawn davon erfahren, was die Mutter getan hat.
Da relativiert nur eine Frau, die möglicherweise psychiatrische Behandlung bräuchte, vor laufender Kamera, wie sie das Leben ihres Kindes und deren Freunden zur Hölle gemacht hat mit den Worten: "Jeder macht mal etwas Illegales – nur ich wurde eben dabei erwischt."
Da spricht Lauryn darüber, dass sie sich trotz allem ohne ihre Mutter nicht vollständig fühlt und sie unbedingt wieder in ihrem Leben haben möchte, sobald sie volljährig ist und das gegen die Mutter verhängte Kontaktverbot nicht mehr gilt.
Empfehlungen der Redaktion
Viele Momente von "Unbekannte Nummer" sind kaum zu ertragen. Dafür hat die Filmemacherin Skye Borgman mit ihrem Schnitt gesorgt. Borgman weiß, was sie da tut. Von ihr ist auch die True-Crime-Doku "Das Mädchen auf dem Bild" und "Abducted in plain Sight", nicht minder verstörende und effekthascherisch aufgebaute Netflix-True-Crime-Dokus. Einmal mehr beweisen Borgman und auch Netflix, dass ihr Fokus nicht auf seriösem und verantwortungsvollem Journalismus liegt, sondern auf Unterhaltung – und das um jeden Preis. Auch auf Kosten der eigenen Protagonisten.
Das Echo, der Hass, die Anschuldigungen, das Victim Blaming lassen auf TikTok nicht lange auf sich warten. Zuschauer sprechen und schreiben ihre Anschuldigungen, etwa, dass Lauryn selbst in die ganze Sache verwickelt gewesen sein müsse. Weil sie nicht geschockt genug reagiert habe. Oder dass Khloe eben ein schlechter Mensch sei und Schlechtes verdient habe. Der Hass, der Schrecken, hat für Lauryn und die anderen Jugendlichen kein Ende gefunden. Doch dieses Mal kommt er nicht von einer unbekannten Nummer, sondern von Menschen aus dem Internet.