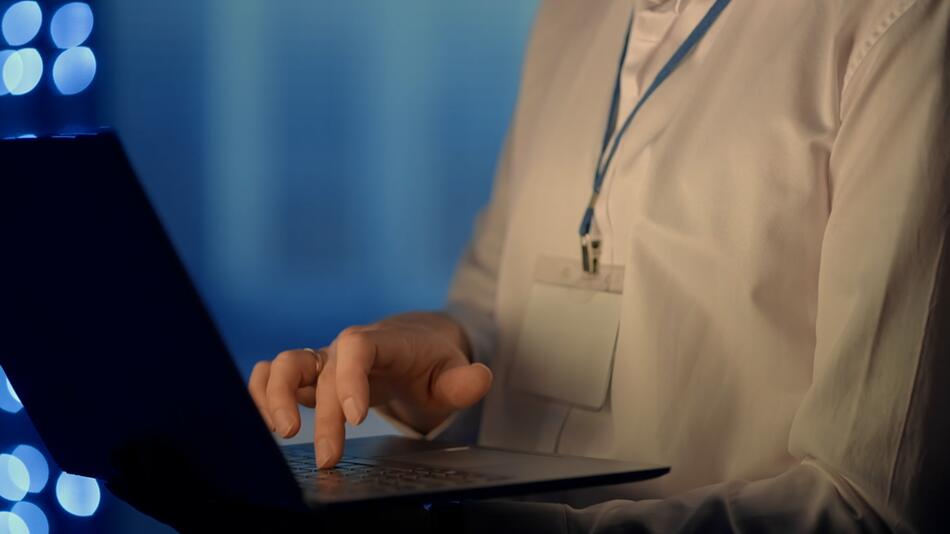Polizeiarbeit ist nur selten so spannend wie im Krimi. Der Alltag der Ermittler besteht meist aus stundenlangem Aktenwälzen. Doch künstliche Intelligenz könnte die Verbrechensbekämpfung grundlegend verändern. Denn KI kann den Blick auf Details lenken, die für das menschliche Auge verborgen bleiben.
Ermittlungsberichte, Vernehmungsprotokolle, forensische Gutachten, Abhörprotokolle oder E-Mail-Auswertungen, Fotos, Videos, Kartenmaterial: Bei komplexen Verbrechensermittlungen sammeln sich enorme Mengen an Daten an. Wenn es um Serientäter geht, kann der Berg an angehäuften Unterlagen schnell auf Zehntausende oder gar Hunderttausende Seiten anwachsen.
Das bedeutet für die mit dem Fall befassten Beamten endlose Stunden lesen, auswerten, Zusammenhänge herstellen. Doch gerade beim letzten Punkt stößt das menschliche Gehirn irgendwann an seine natürlichen Grenzen. Längst bauen Ermittler deshalb auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz.
"Eine Spur ist immer eine Funktion in Ort und Zeit. Wenn ich diese Elemente kopple, dann kann ein Netzwerk helfen, Lösungen zu finden." Das sagt der digitale Forensiker Dirk Labudde. Dazu nutzen er und sein Team sowohl "Large Language Models" (LLMs), also Sprachmodelle ähnlich wie ChatGPT als auch sogenannte "Physics-informed neural networks" (PINNs), die mit physikalischen Gesetzen arbeiten.
Schneller, präziser: KI analysiert gigantische Datenmengen in Sekunden
Der Vorteil: Die KI analysiert gigantische Datenmengen in Sekunden. Dabei ist sie auch noch präziser als der Mensch und erkennt darüber hinaus verborgene Muster. Dieser letzte Punkt ist für Labudde die eigentliche Geheimwaffe der KI. "LLMs können alle Zusammenhänge suchen, und daraus können wir ein Assoziationsnetzwerk bauen", so Labudde. "Das ist die Grundlage für unsere Arbeit. Es geht um die Frage: Ist alles richtig oder gibt es Ketten, die abgebrochen sind? Und bringt mich die Verkettung näher an die Lösung?"
Der Forensiker gibt ein Beispiel: "Zu einem Fall kann es zum Beispiel bis zu 40 Aktenordner geben. Wenn dort in einer Akte eine Schusswaffe auftaucht, dann müssen wir uns fragen: Gibt es irgendwo einen Verletzten?" Dieser Verletzte kann aber an einem ganz anderen Ort, in anderem Zusammenhang auftauchen, also auch in einer anderen Akte. Die KI kann solche Zusammenhänge erkennen, der Mensch oftmals nicht. "Die Informationen, die ich habe, muss ich mit anderen verknüpfen", so Labudde. "Nur so erlangen wir Wissen. Dabei helfen intelligente Systeme."
Lesen Sie auch
- Lernen mit Künstlicher Intelligenz: Macht KI eigentlich dumm?
- Schule im KI-Zeitalter: Wie dramatisch Künstliche Intelligenz das Lernen verändert
Die KI als Sparringspartner: Wo ist die beste Spur zum Täter?
Labudde hat mit dem Einsatz von KI-Technologien bereits dazu beigetragen, den vermeintlichen Antisemitismus-Skandal um Gil Ofarim aufzuklären. Auch bei den Untersuchungen zum Münzraub im Bode-Museum in Berlin war Labudde involviert.
KI-Systeme nutzt er am liebsten als eine Art Sparringspartner. Immer wenn es nicht weitergeht, kann die KI Hinweise geben, wo man weitersuchen kann. Wie eine Art Einwechselspieler, der nochmal völlig neue Impulse bringt.
Labudde bringt ein weiteres Beispiel: Am Tatort gibt es einen Schuhabdruck, man kennt die Größe und das Modell des Schuhs. Nun müsste man sich auf die Suche nach dem Besitzer machen. Eine mühsame und langwierige Arbeit. "Aber vielleicht gibt es stattdessen andere lose Enden, die man aufgreifen könnte?", so der Forensiker. Auf diese losen Enden macht vielleicht erst die KI aufmerksam. Das könne zum Beispiel ein Phantombild sein, das einer Aufnahme aus einer öffentlichen Kamera ähnelt. "Es geht also um einen Perspektivwechsel", so Labudde.
Wie künstliche Intelligenz neue Perspektiven bei Cold Cases eröffnet
Insbesondere bei sogenannten "Cold Cases" kann ein Perspektivwechsel extrem wertvoll sein. Als Cold Cases bezeichnet man ungelöste Kriminalfälle, bei denen alle Ermittlungsansätze erschöpft sind und die deshalb vorübergehend als "abgeschlossen" gelten. Oft haben sich an solchen Fällen ganze Generationen an Ermittlern die Zähne ausgebissen.
KI könnte für Cold Cases ein Wendepunkt sein, wie einst die DNA-Analyse. Die Möglichkeit, DNA zu erfassen und zu analysieren, führte in den 1990er Jahren dazu, dass zahlreiche solcher Cold Cases gelöst wurden.
Ein weiteres Anwendungsfeld für KI ist die Audio- und Bildverbesserung. Labudde nutzt die Technologie, um schlechte Tonaufnahmen zu verbessern oder Erkenntnisse über die Art des Raumes zu gewinnen. Oder Sprecher zu erkennen, die sich für jemand anderen ausgeben.
Ein weiterer Ansatz ist, Bilder zu verschriftlichen. "Dann vergleicht die KI den Text mit den Daten in der Akte und untersucht, ob sich jemand semantisch ähnlich geäußert hat", erklärt Labudde. All das seien nur kleine Bausteine, erläutert Labudde. "Wenn wir die aber auf unser Netzwerk legen, bekommen wir neue Hinweise."
Rasante Entwicklung bei KI-Techniken: Stirbt das Verbrechen aus?
Menschen seien nun mal nicht dafür gemacht, Nebenstränge zu erfassen, so Labudde. "Wenn wir zum Beispiel einen Roman lesen, vergessen wir die Nebenstränge schnell. Aber so eine Akte besteht nur aus Nebensträngen."
Empfehlungen der Redaktion
Das BKA arbeitet mit leistungsfähigen eigenen Tools. Trotzdem sieht Labudde Nachholbedarf in Europa: "Die meisten Innovationen kommen aus den USA." Die Entwicklung ist rasant und wird laut Labudde so weit gehen, dass es "digitale Zwillinge" von Verdächtigen geben wird.
Ob KI sogar dazu führen kann, dass das Verbrechen irgendwann komplett ausgelöscht wird? Daran zweifelt Labudde, denn auf beiden Seiten gebe es immer wieder neue Ideen. Sicher dürfte sein: Die Ganoven werden es in Zukunft definitiv nicht leichter haben.
Über den Gesprächspartner
- Prof. Dr. rer. nat. Dirk Labudde leitet die Fachgruppe Forensik an der Fakultät Angewandte Computer‐ und Biowissenschaften der Hochschule Mittweida. Unter anderem untersuchte er den vermeintlichen Antisemtismus-Skandal um
Gil Ofarim und den Münzraub im Bode-Museum in Berlin.