Wer eine Panikattacke erleidet, durchlebt oft Todesängste vor einer Gefahr, die nicht da ist. Woher diese massive Reaktion des Körpers kommt, ist schwer zu verstehen. Psychotherapeutin Klara Hanstein gibt im Interview Betroffenen und ihren Angehörigen Tipps.
Plötzlich fängt das Herz an zu rasen, Schweiß bricht aus, der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Ein uralter Instinkt bereitet uns auf diese Weise auf Gefahren vor - eine sogenannte "Fight or Flight"-Reaktion. Adrenalin schießt durch den Körper, damit wir davonlaufen können. Das Problem: Es gibt gar keine Gefahr.
Panikattacken kommen oft aus dem Nichts und versetzen Betroffene in Todesangst. Psychotherapeutin und Psychologin Klara Hanstein nennt es einen Fehlalarm, den der Körper beziehungsweise das Nervensystem auslöst. In ihrem Buch "Hey Panik, komm mal wieder runter!", das am 24. September im Kailash Verlag erscheint, gibt sie Betroffene praktische Tipps und Strategien an die Hand, um im Alltag und in Akutsituationen besser gewappnet zu sein. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie außerdem darüber, woran man Panikattacken erkennen kann, und gibt Tipps, wie Außenstehende und Angehörige in diesen Extremsituationen angemessen reagieren.
Kommen Panikattacken immer aus dem Nichts oder können sie auch durch bestimmte Gründe ausgelöst werden?
Klara Hanstein: Sie können definitiv auch Gründe haben. Also prinzipiell gibt es schon Ursachen, meistens auch für Panikstörungen. Aber in der Situation treten sie meist plötzlich und unerwartet auf. Darum erleben Betroffene auch eine Art Schockzustand. Das Herz beginnt plötzlich zu rasen, obwohl man in einer völlig sicheren Situation ist - zum Beispiel in der Supermarktschlange oder im Wartezimmer beim Arzt. Und plötzlich kommen diese Gefühle, vermischen sich dann mit den Gedanken, der Körper spielt verrückt und schon steht die Panikattacke vor der Tür.
Welche Unterschiede bestehen zwischen Panik- und Angstattacken? Gibt es prinzipiell unterschiedliche Arten?
Hanstein: Ich glaube schon, dass man da unterscheiden muss. Panikattacken sind ja wirklich die Form von Angst, die innerhalb ganz kurzer Zeit ein absolutes Maximum erreicht. In dem Moment ist wirklich eine ganz intensive Angst da, bei der auch der Körper meistens sehr involviert ist. Da wird praktisch ein Notfallprogramm ausgelöst, das den Körper enorm hochfahren lässt. Das heißt, die Angstzentrale löst im Kopf einen Alarm aus und der Körper reagiert darauf. Er bekommt die Information: "Hey, hier ist irgendwo eine Gefahr. Wir müssen uns jetzt schützen. Wir müssen entweder davonlaufen oder uns gegen einen Angreifer wehren." Somit wird der Atem schneller, der Puls geht hoch - eine Reaktion, um den Körper darauf vorbereiten zu können, eine Gefahr abzuwehren. Das ist ein uralter Instinkt.
Es gibt aber noch andere Formen von Ängsten, wie etwa Angststörungen. Betroffene einer generalisierten Angststörung zum Beispiel machen sich den ganzen Tag Sorgen über die Zukunft, ob den Kindern oder dem Partner etwas passiert, ob man selbst eine Krankheit bekommt. Das ist dann wie ein ständiges Gedankenkarussell, das in den meisten Fällen aber nicht dieses Maximum erreicht wie eine Panikattacke. Bei einer Panikattacke sind die Betroffenen wirklich massiven Todesängsten ausgeliefert. Viele denken in dem Moment: "Mit mir stimmt etwas nicht. Ich habe einen Herzinfarkt. Ich habe eine Lungenembolie. Ich überlebe diese Situation nicht." Und das löst logischerweise massive Panik aus.
Kann das auch als Einzelphänomen auftreten?
Hanstein: Ja. Es gibt auch Menschen, die haben eine einzige Panikattacke gehabt. Das ist aber in vielen Fällen auch ein sehr einschneidendes Erlebnis - fast schon wie ein traumatisches Erlebnis. Die Folge ist dann meistens die Angst vor der Angst. Das heißt, dass Menschen, die beispielsweise eine Panikattacke beim Autofahren hatten, jedes Mal an dieses schlimme Erlebnis erinnert werden, wenn sie ins Auto steigen. Dann macht sich die Angst wieder bemerkbar, Schweiß bricht aus und das Herz beginnt zu rasen. Und dafür reicht bereits eine einzige Panikattacke aus.
Was sollten Betroffene tun, die erstmals eine Panikattacke erlitten haben?
Hanstein: Das Problem ist, dass viele Menschen gar nicht erkennen, dass sie eine Panikattacke haben. Sie denken, sie leiden an einem körperlichen Problem und lassen das Herz und die Lunge untersuchen. Es ist auch absolut wichtig, diese Dinge ärztlich abklären zu lassen, wenn man Symptome an sich entdeckt, die man nicht kennt.
Aus meiner psychologischen und psychotherapeutischen Sicht kann ich nur raten, sich auch therapeutische Unterstützung zu suchen, um sich das Thema anzusehen: Woher kam denn das eigentlich? Wie kam es zu dieser Attacke? Ich finde es auch enorm wichtig, Wissen an die Hand zu geben, um zu verstehen, was da eigentlich mit mir passiert. Denn ich war selbst Betroffene und konnte das selbst als Psychotherapeutin einfach nicht rational einordnen. Darum war es für mich wichtig, mir dieses Wissen anzueignen, das ich in meinem Buch "Hey Panik, komm mal wieder runter!" weitergeben möchte.
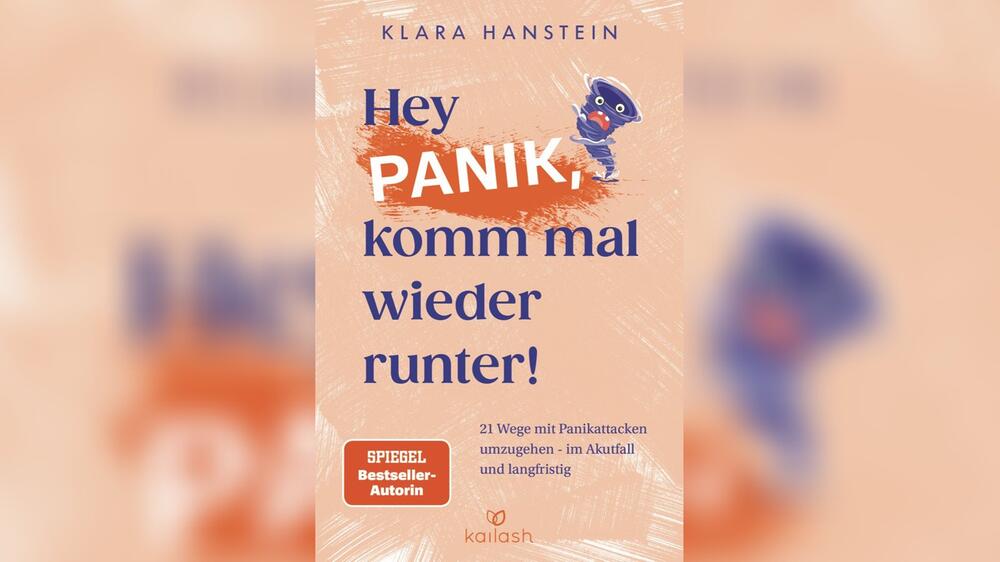
Für viele Betroffene ist es enorm wichtig zu verstehen, dass der Körper mich in diesem Moment eigentlich schützen will und mich darauf vorbereitet, vor einer Gefahr davonzulaufen. Der zweite Schritt ist dann der Umgang mit diesen Panikattacken. Es gibt verschiedene Übungen, um sich und das Nervensystem in diesem Moment wieder zu beruhigen. Dazu eignen sich zum Beispiel Atemübungen sehr gut. Über unseren Atem haben wir direkt Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem und können da wieder Ruhe hinbringen, wo sehr viel Aufregung ist.
Gibt es etwas, was man als außenstehende Person tun kann, wenn jemand eine Panikattacke erleidet?
Empfehlungen der Redaktion
Hanstein: Wenn der Verdacht besteht, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte und man nicht sicher weiß, ob es eine Panikattacke ist, sollte man als Außenstehender einfach den Notruf wählen oder gemeinsam in die Notaufnahme fahren. Wenn aber klar ist, dass es sich um eine Panikattacke handelt und die Person wahrscheinlich öfter unter diesen Symptomen leidet, dann ist es als Außenstehender wichtig, selbst Ruhe zu bewahren. Es gibt Forschung aus der Traumatherapie, die zeigt, dass das ruhige Nervensystem einer Person sich beruhigend auf das Nervensystem der betroffenen Person auswirken kann. Darum ist es wichtig, bei der Person zu bleiben, sie nicht alleine zu lassen und ruhig mit ihr zu sprechen. Es ist auch enorm hilfreich, wenn man als Außenstehender die Situation einordnet, indem man zum Beispiel sagt: "Du weißt, du leidest jetzt gerade wieder unter einer Panikattacke. Du weißt aber, es kann dir nichts passieren. Wir atmen jetzt ein bisschen gemeinsam." Wichtig ist auch, Hilfe anzubieten, aber nicht aufzuzwingen.
Kann es sinnvoll für Betroffene sein, einen Angehörigen einzuweihen?
Hanstein: Absolut. Diesen Tipp gebe ich auch in meinem Buch, in einem ruhigen Moment, in dem es der betroffenen Person gut geht, gemeinsam einen Notfallplan zu erarbeiten. Man kann besprechen, was in der Vergangenheit schon geholfen hat und vielleicht beim nächsten Mal helfen könnte oder was der Angehörige in der Situation anbieten könnte. Wichtig ist aber immer zu beachten, dass bei der nächsten Panikattacke auch etwas anderes helfen kann. Also das bedeutet jetzt nicht, dass es ein Schema gibt, nach dem man immer vorgehen kann. Man muss verschiedene Dinge durchgehen und anbieten. Aber das kann der betroffenen Person eben auch sehr viel Sicherheit geben. (sv/spot) © spot on news
