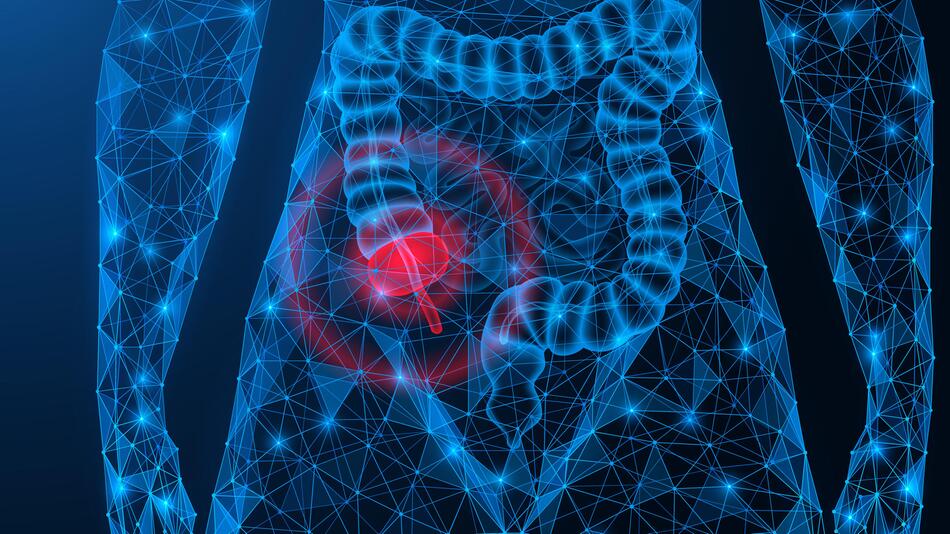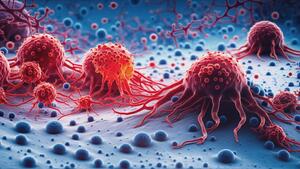Lange galt Blinddarmkrebs als medizinische Rarität. Doch aktuelle Daten zeigen, dass die Erkrankung zunehmend auch jüngere Menschen trifft. Das Tückische: Sie ist sehr schwer zu erkennen.
Blinddarmkrebs ist extrem selten. Doch wie jüngst eine Studie der Vanderbilt University zeigte, nimmt die Zahl der Fälle bei jungen Erwachsenen seit Jahren zu. Besonders Menschen, die nach 1985 geboren wurden, scheinen deutlich häufiger betroffen zu sein als frühere Generationen. Doch warum ist das so? Und wie erkennt man Appendixkarzinome früh genug?
Die Studie analysierte die Krankengeschichten von über 31.000 Patientinnen und Patienten mit Blinddarmkrebs, die zwischen 1975 und 2019 in das nationale Krebsregister aufgenommen worden waren. Die Forschenden stellten fest, dass die Erkrankungsrate bei Personen, die zwischen 1981 und 1989 geboren wurden, rund viermal so hoch war wie bei der Vergleichsgruppe der zwischen 1941 und 1949 Geborenen. Menschen, die zwischen 1976 und 1984 geboren wurden, waren etwa dreimal so häufig betroffen.
"Die aktuellen Daten zeigen, dass die Inzidenz von Appendixkarzinomen, insbesondere Adenokarzinomen (bösartige Tumorform, die aus Drüsengewebe hervorgeht; Anm.d.Red.), bei jüngeren Erwachsenen zunimmt", sagt Michael Sigal, Gastroenterologe an der Charité. Auffällig sei der parallele Trend zu mehr Dickdarmkrebsfällen bei jungen Patientinnen und Patienten. Ob beide Phänomene dieselben Ursachen teilen, sei aber noch unklar.
Welche Symptome und Warnzeichen gibt es?
Blinddarmkrebs gilt als besonders tückisch, weil seine Symptome sehr unspezifisch sind. "Sie ähneln denen einer akuten Blinddarmentzündung: Schmerzen und Druckempfindlichkeit im rechten Unterbauch, gegebenenfalls auch Erschöpfung, Übelkeit und Fieber", erklärt Sigal.
Weil diese Beschwerden oft auf eine vermeintlich harmlose Ursache zurückgeführt werden, wird der Tumor häufig erst spät oder nur durch Zufall entdeckt, etwa bei einer Blinddarmentfernung. Spezifische Warnzeichen für junge Menschen existieren nicht.
Auch moderne bildgebende Verfahren stoßen bei der Früherkennung an ihre Grenzen: "Sie erfassen meist nur größere Tumore oder fortgeschrittene Stadien", so Sigal. Kleinere Veränderungen oder Frühstadien bleiben gewöhnlich unentdeckt. Selbst eine Darmspiegelung bringt nur dann Klarheit, wenn der Tumor direkt im Inneren des Darms liegt.
Warum Menschen ein Appendixkarzinom entwickeln, ist bisher kaum erforscht. Anders als bei Dickdarmkrebs, für den chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, starkes Übergewicht oder bekannte genetische Dispositionen als Risikofaktoren gelten, lassen sich beim Blinddarmkrebs bisher keine klaren Auslöser benennen.
Warum betrifft Blinddarmkrebs so viele Millennials?
Auch warum die Zahl der Erkrankungen ausgerechnet bei jungen Erwachsenen in der Generation der Millennials (also zwischen 1981 und 1996 Geborenen) steigt, stellt Forschende aktuell noch vor ein Rätsel. Eine einzelne genetische Ursache gilt zum aktuellen Zeitpunkt als unwahrscheinlich.
Zwar vermuten Fachleute, dass Umweltfaktoren und moderne Lebensgewohnheiten, die sich über die letzten Generationen verändert haben – etwa hoch verarbeitete Lebensmittel, Bewegungsmangel oder zuckerhaltige Getränke – eine Rolle spielen könnten. Bewiesen ist das aber noch nicht. "Es ist gut möglich, dass ähnliche Risikofaktoren wie beim kolorektalen Karzinom (Dickdarmkrebs; Anm.d.Red) mitverantwortlich sind", sagt Sigal. "Aber wir wissen es noch nicht. Da Appendixkarzinome so selten sind, gibt es bisher keine belastbaren Daten."
Wie gut sind die Heilungschancen?
Die Behandlung von Blinddarmkrebs richtet sich stark nach Tumortyp und -stadium. "Auch in einem frühen Stadium reicht die Entfernung des Blinddarms häufig nicht aus", sagt Sigal. Stattdessen ist in vielen Fällen eine erweiterte Darmresektion notwendig, also das Entfernen eines größeren Darmabschnitts. "In der Regel wird das aber gut vertragen. Wichtig ist dann trotzdem eine entsprechende Nachsorge, um mögliche Probleme kurzfristig zu erkennen", ergänzt der Experte.
Ist der Krebs schon weiter fortgeschritten, wird es komplizierter: In diesen Fällen braucht es eine multimodale, individuell zugeschnittene Therapie, beispielsweise mit Chemotherapie oder zielgerichteten Medikamenten. "Da es sich um eine seltene Erkrankung handelt, ist eine Vorstellung in einem größeren onkologischen Zentrum sicher sinnvoll, um eine individuelle Therapie und Nachsorge zu identifizieren", so Sigal.
Empfehlungen der Redaktion
Wie gut die Heilungschancen sind, hängt, wie bei den meisten Krebserkrankungen, maßgeblich vom Zeitpunkt der Diagnose ab. Wird das Karzinom früh entdeckt und operativ entfernt, ist die Prognose optimistisch. In späteren Stadien und bei aggressiven Varianten sinken die Erfolgsaussichten deutlich, zumal Tumore dann häufig bereits gestreut haben.
Umso wichtiger ist es laut Sigal, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. "Zwar gibt es bisher noch keine spezifische Früherkennung für Appendixkarzinome, aber die generelle Dickdarmkrebsvorsorge in Form einer Darmspiegelung ist auf jeden Fall sinnvoll, da dieser Tumortyp auch bei Jüngeren viel häufiger auftritt und man mit der Darmspiegelung nicht nur die Vorstufen erkennen, sondern auch entfernen kann." Künftig könnten auch Blut- oder Stuhltests zur Früherkennung seltener Tumore wie dem Appendixkarzinom beitragen. Aktuell befinden sie sich aber noch in der Entwicklung.
Über den Gesprächspartner
- Prof. Dr. med. Michael Sigal ist Oberarzt und W2-Professor für Translationale Gastrointestinale Onkologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Er leitet den Bereich Luminale Gastroenterologie sowie eine Emmy-Noether-Forschungsgruppe, die erforscht, wie Entzündungen und Umweltfaktoren zur Entstehung von Darmkrebs beitragen. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem UEG Rising Star Award und einem ERC Starting Grant.
Verwendete Quellen
- VUMS News: Study shows sharp increase in appendix cancer for Generation X and millennials
- Universitätsklinikum Leipzig: Darmkrebs trifft immer häufiger auch junge Menschen