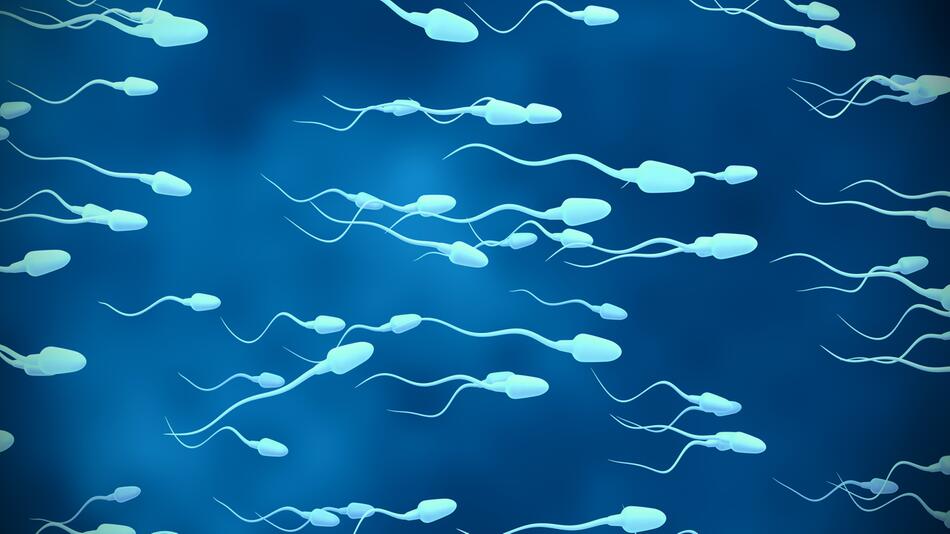In vielen Ländern werden die Menschen immer später Eltern. Dass das gewissen Risiken mit sich bringt, ist bekannt. Forscher haben in einer Studie nun das Risikoausmaß für krankheitsfördernde Mutationen in Spermien untersucht.
Mit dem Alter von Vätern steigt das Risiko dafür, dass sie gefährliche Erbgutveränderungen an ihren Nachwuchs weitergeben. Ein Grund dafür ist die Anhäufung von Mutationen in Spermien und deren Vorläuferzellen. Britische Forschende haben nun in einer Studie 81 Samenproben von 57 gesunden Männern gezielt auf solche Veränderungen hin mit einem besonders genauen Verfahren analysiert.
Dabei lag der Anteil von Genen, die krankheitsfördernde Mutationen trugen, bei Männern im Alter von 30 Jahren bei etwa 2 Prozent. Bei Männern mittleren und höheren Alters – ab 50 Jahren – liege er bei schätzungsweise 3 bis 5 Prozent, wie die Gruppe um Raheleh Rahbari vom Wellcome Sanger Institute im britischen Hinxton im Fachblatt "Nature" berichtet. Im Alter von 70 Jahren waren es demnach 4,5 Prozent.
Allerdings geht diese Zunahme nicht nur auf die Häufung zufälliger Mutationen in den Spermien zurück. Zudem böten manche Mutationen bei der Bildung der Samenzellen in den Hoden auch einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Zellen ohne diese Veränderungen. Insgesamt identifizierte die Gruppe 40 Gene, bei denen bestimmte Veränderungen Vorteile bieten. 31 davon waren bisher nicht bekannt. Oft hingen die Mutationen mit dem Verlust bestimmter Funktionen zusammen.
Nicht alle Mutationen erhöhen Krankheitsrisiko für das Baby
Viele der betroffenen Gene seien mit einem erhöhten Risiko etwa für Krebserkrankungen oder Entwicklungsstörungen verbunden. Allerdings sei das Alter von Vätern meist geringer als das der älteren Studienteilnehmer, merkt das Team an. Daher dürfte der Einfluss des Alters eher etwas bescheidener ausfallen.
"Unsere Resultate haben bedeutende Auswirkungen auf Studien zu Evolution und Krankheiten, die sich auf Modelle zu Keimbahn-Mutationen stützen und die positive Selektion derzeit nicht berücksichtigen", schreibt die Gruppe. Das Team räumt jedoch ein, dass nicht alle solchen Mutationen Krankheitsrisiken für späteren Nachwuchs erhöhen müssen. Manche davon könnten auch etwa die Befruchtung oder die Entwicklung des Embryos beeinträchtigen.
Mutationsrate von Keimzellen ist relativ niedrig
Welche gesundheitliche Bedeutung Mutationen konkret für Nachkommen hätten, müsse noch weiter untersucht werden, betonen die Forschenden. "Gleichwohl kann das wachsende Bewusstsein über diese Risiken Interesse in Familienplanung, genetische Beratung und klinische Interventionen anregen", heißt es in der Studie.
Bekannt war bereits, dass die Mutationsraten in Keimzellen – dazu zählen neben den Spermien auch die Eizellen – deutlich niedriger sind als in Zellen vieler anderer Gewebetypen. Auch die aktuelle Studie ergab, dass die Mutationsrate etwa in Blut achtmal höher ist als in Spermien.
Empfehlungen der Redaktion
"Es gibt die gängige Annahme, dass Keimlinien wegen ihrer niedrigen Mutationsraten gut geschützt sind", wird Studienleiterin Rahbari in einer Mitteilung ihres Instituts zitiert. "Aber tatsächlich ist die männliche Keimbahn eine dynamische Umgebung, in der die natürliche Selektion gefährliche Mutationen begünstigen kann – manchmal mit Konsequenzen für die nächste Generation." (Walter Willems, dpa/bearbeitet von mak)