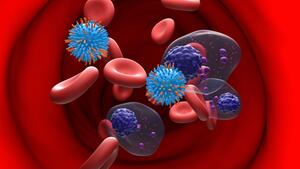Eine winzige genetische Veränderung schwächt das menschliche Immunsystem im Kampf gegen Tumorzellen. Dieses Wissen könnte die Krebs-Immuntherapien voranbringen.
Der Mensch und sein nächster Verwandter, der Schimpanse, sind genetisch fast identisch: Sie teilen 98,8 Prozent ihrer Erbanlagen. Doch ein kleiner Unterschied in den übrigen 1,2 Prozent sorgt offenbar dafür, dass Schimpansen deutlich seltener an Krebs erkranken.
Forschende der University of California Davis haben zumindest Hinweise dafür gefunden, dass der evolutionäre Schritt vom Menschenaffen zum Menschen auf Kosten der Immunabwehr gegen Tumoren geht: Menschliche Krebszellen entziehen sich demnach dem Tod durch die körpereigene Immunattacke leichter als Krebszellen der Schimpansen.
Schimpansen haben besseren Krebsschutz
Tumoren der Brust, Prostata oder der Lunge sind für mehr als 20 Prozent der Todesfälle bei Menschen verantwortlich. Bei Menschenaffen dagegen liegt die Häufigkeit unter zwei Prozent. Seit einigen Jahren versuchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herauszufinden, warum Menschen häufiger an Krebs erkranken als ihre nächsten tierischen Verwandten.
Das Team von Jogender Tushir-Singh fand nun einen kleinen, aber wichtigen Unterschied bei einem Molekül, das eine Gruppe von Immunzellen, die sogenannten T-Zellen, auf ihrer Oberfläche trägt. Über dieses Molekül, Fas-Ligand oder kurz FasL, können aktivierte T-Zellen das Absterben einer Krebszelle in Gang bringen.
Das funktioniert so: Die FasL-Moleküle der T-Zelle binden sich an ihre passenden Gegenüber, die Fas-Rezeptoren (FasR) auf der Krebszelle. Genau diese Bindung versetzt der Krebszelle den Todesstoß. Sie setzt in ihrem Inneren Prozesse in Gang, die letztlich einen programmierten Zelltod herbeiführen. Fachleute nennen das Apoptose. T-Zellen nutzen diese Fähigkeit, um gefährliche oder überflüssige Zellen zu beseitigen. Doch expansionswütige Tumorzellen entwickeln ihrerseits Strategien, um dieser Aufforderung zum Selbstmord zu entgehen.
An dieser Stelle kommt das Enzym Plasmin ins Spiel. Als natürlicher Bestandteil des Blutserums hat das Plasmin eine wichtige Rolle bei der Auflösung von Blutgerinnseln. Allerdings kommt dieses Enzym in auffällig erhöhten Werten auch im Gewebe von etwa Brust-, Darm- oder Eierstockkrebs vor. Das ist kein Zufall. Plasmin kann als eine Art molekulare Schere manche Proteine gezielt zerschneiden und damit zum Beispiel Blutgerinnsel auflösen.
Auch FasL ist ein Protein und aus insgesamt 281 Aminosäuren aufgebaut. Plasmin kann auch FasL zerschneiden und damit unschädlich machen. Das funktioniert aber nur, wenn sich an Position 153 der Aminosäurekette, die das FasL bildet, die Aminosäure Serin befindet. Schimpansen hingegen haben an dieser Stelle Prolin, das dem Plasmin keinen Angriffspunkt bietet. Dadurch bleibt FasL bei Schimpansen stabil und kann Tumorzellen zuverlässig zerstören. Das haben Jogender Tushir-Singh und sein Team herausgefunden.
Durch das Plasmin im Tumorgewebe entkommen beim Menschen die Krebszellen der Immunattacke: Das Plasmin spaltet die FasL-Moleküle, sie können nicht an ihr Gegenüber, das FasR, auf der Krebszelle andocken, also keinen Selbsttod auslösen. Bei den Schimpansen dagegen funktioniert dieser immunologische Krebsschutz reibungslos: FasL können in der Mikroumgebung des Tumors nicht durch das Plasmin funktionsuntüchtig gemacht werden, sie bleiben stabil und sorgen für den Tod der Tumorzelle.
Dass diese Prozesse tatsächlich entscheidend sind, zeigen weitere Laborexperimente des kalifornischen Teams. Blockierten die Forschenden gezielt die Plasmin-Angriffsstelle am FasL etwa mit Präzisionsantikörpern, blieb die FasL-vermittelte Killing-Funktion der T-Zellen erhalten.
Aktuelle Studie könnte Immuntherapien verbessern
T-Zellen sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Immuntherapien gegen Krebs. Mithilfe einer Gruppe von Medikamenten, den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, werden T-Zellen zum Beispiel angriffslustiger gemacht in ihrem Kampf gegen Tumorzellen. Im Rahmen der CAR-T-Zell-Therapie werden dem Patienten T-Zellen entnommen und im Labor mit speziellen Tumorerkennungsrezeptoren ausgestattet, vermehrt und schließlich über das Blut zurückgegeben.
T-Zell-Therapien sind bei einigen Blutkrebsarten teilweise sehr erfolgreich. Bei festen Tumoren, etwa der Lunge, des Darms, der Leber oder der Brust, fehlt es oft noch an Durchschlagskraft. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem sind solide Tumoren wegen ihrer Kompaktheit und räumlichen Abgegrenztheit im Körper für die Immunzellen wesentlich schwerer zugänglich als Blutkrebszellen.
Das Team aus Kalifornien hofft, dass künftig T-Zell-basierte Immuntherapien in Zukunft effektiver werden: Durch Kombination mit etwa Plasmin-Hemmstoffen, die FasL schützen, hoffen sie, die Immunantwort gegen den Tumor noch weiter steigern zu können.
Viele Fragen bleiben offen
Noch ist allerdings unklar, welche Nebenwirkungen solche zusätzlichen Wirkstoffe haben werden. Schließlich ist Plasmin ein wesentlicher Bestandteil der Blutgerinnungskontrolle im menschlichen Körper. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zum Umgang des menschlichen Immunsystems mit Krebszellen und deren Taktiken, der Körperabwehr zu entkommen. Doch bevor daraus neue Therapien entstehen, müssen noch viele Fragen geklärt werden.
Der FasL-Weg ist nur einer, über den die Immunabwehr Krebszellen beseitigen kann. Es gibt noch einige mehr. T-Zellen schütten etwa auch Moleküle aus, die Perforine, die die Membran der Krebszelle durchlöchern und sie dadurch quasi auflösen. Zudem gibt es weitere genetische Unterschiede zwischen Schimpanse und Mensch. Ältere Studien etwa finden auch Differenzen bei Tumorsuppressor-Genen und bei solchen Erbanlagen, die die Fähigkeit des Körpers betreffen, DNA-Schäden zu beheben.
Ein wesentlicher und entscheidender Unterschied sind jedoch die Lebensumstände und die Lebensdauer. Affen sterben früher, sie ernähren sich anders und sind anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Eine erhöhte Krebsanfälligkeit der Menschen im Vergleich zu Menschenaffen vermuteten Forschende der University of California in San Diego bereits vor zehn Jahren.
Doch wie hoch dieser Unterschied tatsächlich ist, blieb unklar, weil die Datenlage begrenzt ist: "Insgesamt gibt es wahrscheinlich nur ein paar tausend nicht-menschliche Primaten, die im letzten Jahrhundert in Gefangenschaft sorgfältig untersucht wurden. Daher können keine zuverlässigen Aussagen über Krankheiten gemacht werden, die in der menschlichen Bevölkerung mit einer relativen Häufigkeit von weniger als 1 pro 100 auftreten", kritisierten sie.
Ein größeres Gehirn auf Kosten der Krebsabwehr?
Welchen Grund mag es gegeben haben, dass die Affen eine andere Variante des FasL behalten haben beziehungsweise, dass sich während der Evolution das FasL des Menschen leicht gegenüber seinen Vorfahren veränderte? "Die evolutionäre Mutation in FasL könnte dazu beigetragen haben, dass das Gehirn beim Menschen größer ist", sagte Jogender Tushir-Singh in einer Pressemitteilung seiner Universität. Im Zusammenhang mit Krebs sei das ein ungünstiger Kompromiss gewesen, weil die Mutation bestimmten Tumoren eine Möglichkeit gebe, Teile unseres Immunsystems zu entwaffnen.
Wie kommt Tushir-Singh auf diese Idee? Wie hängen Tumorattacke und Gehirnentwicklung zusammen? Einer der deutlichsten Unterschiede zwischen Menschen und anderen Primaten ist die Gehirngröße. In der Großhirnrinde des Menschen beispielsweise befinden sich etwa doppelt so viele Zellen wie in der des Schimpansen.
Empfehlungen der Redaktion
Der Zelltod spielt nicht nur bei T-Zell-Attacken eine Rolle, sondern auch während der Embryonalentwicklung. In einem komplex orchestrierten Prozess wachsen vielfältig spezialisierte Körperzellen heran. Organe in definierter Form und Zellzahl entstehen. FasL-vermittelte Prozesse sorgen hier zum Teil für Ordnung, indem sie Zellwachstum stoppen oder den Tod von Vorläuferzellen einleiten, damit Form und Zahl der Gewebezellen eingehalten werden.
Die Idee von Tushir-Singh und seinen Leuten: Der Mensch konnte in einer Plasmin-reichen Umgebung, wie sie wohl auch im Gehirn vorherrscht, mehr Gehirnzellen während der Embryonalentwicklung produzieren, weil das Plasmin den Zelltod stoppte. Der Vorteil in der Gehirnentwicklung könnte die höhere Krebsanfälligkeit des Menschen zur Folge haben – ein evolutionärer Kompromiss zugunsten größerer kognitiver Fähigkeiten.
Verwendete Quellen
- nature.com: Evolutionary regulation of human Fas ligand (CD95L) by plasmin in solid cancer immunotherapy
- springer.com: Comparative analysis of cancer genes in the human and chimpanzee genomes
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center: Cancer Genes in Humans vs. Chimps: Why Are We More Susceptible?
- National Library of Medicine: On the apparent rarity of epithelial cancers in captive chimpanzees
- Pressemitteilung der University of California Davis: A single genetic mutation may have made humans more vulnerable to cancer than chimpanzees
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
© RiffReporter