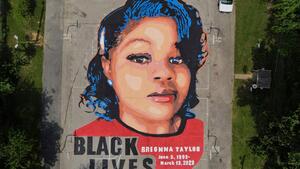Donald Trump jubelt über Anklagen, bedrängt Justizministerium, Richter und Anwälte, fordert Ermittlungen gegen Feinde, verhindert sie gegen sich und Freunde. Ist die offiziell unabhängige US-Justiz nur ein verlängerter Arm des Präsidenten - oder können Gerichte und Staatsanwälte ihn noch stoppen? Ein deutsch-amerikanischer Jurist erklärt den Umbau des Systems, konkrete Vorfälle und beantwortet die Frage, wer wie erfolgreich Widerstand leisten könnte.
Donald Trump jubelt. Über die Anklage gegen James Comey, den er 2017 als FBI-Direktor entließ, nachdem dieser zum Verhältnis
Bondi war ebenso Trumps persönliche Anwältin wie die Staatsanwältin, die jetzt die Anklage erhob. Der vorherige Strafverfolger war aus Protest zurückgetreten. Dieser und andere Vorfälle zeigen, wie skrupellos Trump das US-Justizministerium für seine Zwecke nutzt. Der Spiegel schrieb vom "Ministerium der Rache", MSNBC analysiert, niemand sei mehr vor politischer Verfolgung sicher.
Zwei Varianten: Autoritärer Umbau – oder Diktatur?
Wie unabhängig ist die dritte Gewalt in den USA? Ist die Justiz ein Erfüllungsgehilfe, wie Kongress und Regierung, wo die Trump-Fans dominieren? Oder könnten mutige Juristen ihn sogar stoppen?
Der deutsch-amerikanische Rechtswissenschaftler Mattias Kumm in New York ist aktuell nah dran, aber tut sich im Gespräch mit unserer Redaktion schwer, die Vereinigten Staaten klar einzusortieren.
"Es gibt zwei Perspektiven. Die mildere sieht eine Verfassungskrise, so wie in Ungarn oder Polen", sagt Kumm, sprich: autoritärer Umbau des Staates, unter formeller Einhaltung der Gesetze. "Die schärfere Perspektive ist: Trump wird zum Diktator. Er schert sich nicht ums Recht, er macht einfach und das Juristische wird nachgeschoben." Es spreche einiges für Variante zwei. Vor allem strukturelle Veränderungen in der Strafverfolgung.
Ob Epstein oder Comey – unabhängige Ministerin auf Trumps Linie
Trump baut das Justizministerium personell und organisatorisch um, setzt überall Loyalisten ein. Ziel scheint, Ermittlungen gegen ihn oder Verbündete zu beenden, sie gegen Gegner zu forcieren. Dabei gilt das US-Justizministerium seit Präsident Nixons Watergate-Skandal 1973 als unabhängig.
"Trump bricht mit der Tradition, das Ministerium ist für ihn Instrument der Exekutive", sagt Kumm. Der Justizminister, in den USA oberster Strafverfolger, entscheidet unabhängig über Ermittlungen und Anklagen. Doch egal ob im Fall Epstein oder Comey – Pam Bondi vertritt stets Trumps Linie.
So soll eine Einheit gegen "Instrumentalisierung" staatlichen Macht-Missbrauch untersuchen, aber scheint selbst ein politisches Werkzeug zur Einschüchterung zu sein, die Juristen vielerorts erleben.
Bundesrichter urteilen zu 93 Prozent gegen Trump
Auch von Trump selbst, der öffentlich Richter und Staatsanwälte beleidigt und unter Druck setzt. "Er feuert Staatsanwälte, weil sie sich weigern, Anklagen zu erheben, die er verlangt", sagt Kumm. Auch Bundesgerichte, die zu 93 Prozent gegen Trump urteilen, können ihn kaum stoppen. "Ein Urteil in erster Instanz hat auf nationaler Ebene aber keine aufschiebende Wirkung", erklärt Kumm.
So laufen widerrechtliche Maßnahmen vorerst weiter, bis das oberste Gericht darüber entscheidet, der Surpreme Court. "Er ist inzwischen so besetzt, dass viele glauben, auf dieses Gericht könne man nicht setzen", sagt Kumm, spätestens seit dort drei von Trump ernannte Verfassungsrichter sitzen. Nicht nur Richter, auch Anwälte, die Einwanderer vertreten, werden mittlerweile anonym bedroht.
Die Regierung nutzt alle Mittel, auch Gewalt
Hinzu kommen Trumps Ausfälle über mediale Kanäle, wo er Richter als "radikal links" beschimpft – eine Behauptung, die Kumm "absurd" nennt. Das US-System sorge eher für konservative Richter.
Parallel nutzt die Exekutive ihre Verwaltungsmittel - etwa Fördermittel oder Genehmigungen - um Druck auf Bezirke, Behörden und Gegner vor Gerichtsprozessen auszuüben. "Viele Institutionen und Unternehmen schließen lieber Deals, obwohl sie juristisch im Recht wären, weil langwierige Prozesse und Konflikte mit der Exekutive hohe Kosten nach sich ziehen können", sagt der Experte.
Hinzu kommt offener, teils inszenierter Einsatz von Gewalt: von Einwanderungsagenten im Inland oder das Versenken von Schiffen vor Venezuela, wogegen sich international aber kaum Protest regt.
"Mut ist der Schlüssel"
Ist also kein Mittel gewachsen gegen Trump und seine Unterstützer, auch juristisch nicht? Kumm hält die US-Justiz für stabiler als vielerorts in Europa. "Gerichte sind dezentral, Richter werden auf Lebenszeit ernannt, das ist ein Schutz. Die unteren Instanzen sind schwer zu neutralisieren."
Doch wird das allein nicht reichen in Zeiten, in den das Recht oft dem Rechtsbruch hinterherhinkt. Die Wirksamkeit auch juristischer Gegenmaßnahmen hängt von einem Grad der Unterstützung ab.
Richter, Anwälte und Opposition brauchen Rückhalt von Medien, Unternehmen, Zivilgesellschaft. "Mut ist der Schlüssel", erklärt Kumm, "wenn eine Koalition maßgeblicher Akteure bereit ist, Widerstand zu leisten, erhöhen sich die Chancen, exekutive Überschreitungen zu begrenzen."
Empfehlungen der Redaktion
Richter bedroht, Staatsanwältin überfordert
Für Kongress-Anhörungen und Sonderermittler, die die Unabhängigkeit der Justiz überprüfen, für Schutzregeln für Staats- und Zivilanwälte: Es braucht Mehrheiten, in Parlamenten wie außerhalb. Zwar sind 450 Fälle von Doxing dokumentiert, in denen Richter oft anonym privat bedroht werden. Doch oft gab es Proteste von lokalen Akteuren dagegen. Es besteht also durchaus noch Hoffnung.
Auch im Fall James Comey, wo die neue Staatsanwältin am ersten Prozesstag bereits überfordert wirkte. Von drei Anklagepunkten wisse sie nichts, erklärte sie, Comey ist nun in zweien angeklagt.
Zum Gesprächspartner
- Mattias Kumm ist ein deutsch-US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer, der zu internationalem, europäischem sowie vergleichendem öffentlichem Recht forscht. Er lehrt an der NYU School of Law in New York, hat Forschungsprofessuren am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und an der Humboldt Universität zu Berlin.
Verwendete Quellen
- spiegel.de: Ministerium für Rache
- msnbc.com: If the Trump DOJ can indict Comey, then no one is safe from political prosecution
- abcnews.go.com: Bondi, as new AG, launches 'Weaponization Working Group' to review officials who investigated Trump
- lawshun.com: Trump's Legal Troubles: A Timeline Of His Losses
- cbsnews.com: Federal judges targeted nationwide by "pizza doxxings"
- cbsnews.com: Judge who reviewed James Comey's indictment was confused by prosecutor's handling of case, transcript shows