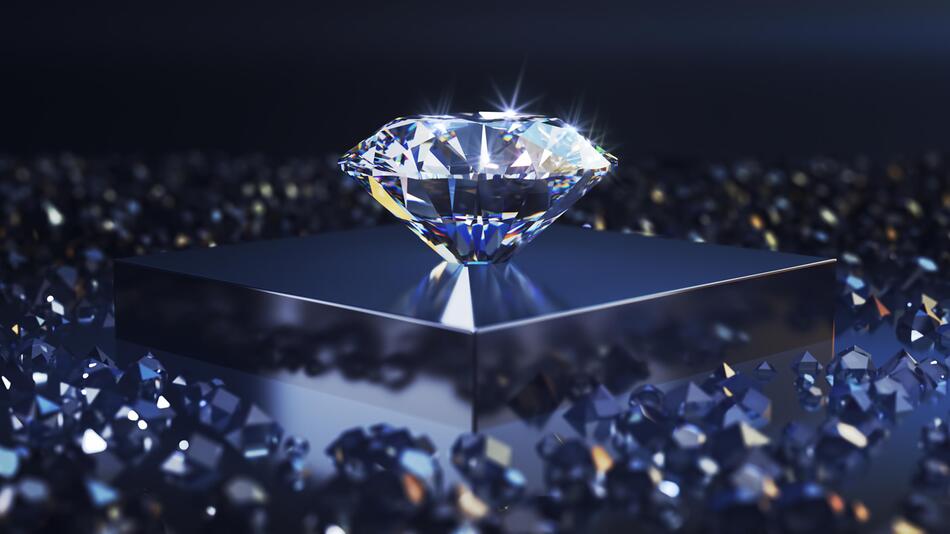Forscher der Universität Warwick haben einen Diamanten-Sensor vorgestellt, der Metastasen finden kann, und bezeichnen ihn selbst als "Game-Changer" in der Krebstherapie. Ein Experte erklärt, wie revolutionär die Entdeckung wirklich ist, wie der Sensor funktioniert und was das für Krebspatienten bedeutet.
"Die Diamanten, die Krebs finden könnten" – so hat die englische Universität Warwick im August ihre neuesten Forschungsergebnisse angekündigt. Diese sollen ein "Game-Changer" in der Krebstherapie sein.
In dem Paper stellen die Forscher um Gavin Morley einen Diamanten-Sensor vor, der Krebspatienten Hoffnung macht. Denn der Sensor soll Metastasen finden. Diese entstehen, wenn Tumorzellen in anderes Gewebe eindringen, sich dann dort ansiedeln und Tochtergeschwülste bilden.
Metastasen oft schwierig zu finden
Häufig verbreiten sich die Tumorzellen über das Lymphsystem, einen Teil unseres Immunsystems. Das Netzwerk aus Gefäßen und Lymphknoten ist wichtig beim Kampf gegen Infektionen und Krebs. Bilden sich bei Krebspatienten Metastasen, sind daher oft die Lymphknoten befallen, die dem Organ, in dem sich der ursprüngliche Tumor befindet, am nächsten liegen. Bei Brustkrebspatientinnen sind das zum Beispiel die Lymphknoten in den Achselhöhlen.
Das Problem: Metastasen sind nicht immer einfach zu finden. Sie können zum Beispiel sehr klein sein, bevor sie Symptome verursachen, und sie treten teilweise erst sehr spät nach Entfernen des ursprünglichen Tumors auf.
Aktuell arbeiten die meisten Kliniken mit radioaktiven Mitteln oder blauer Kontrastfarbe, um Metastasen zu finden. Die Herstellung von radioaktiven Mitteln ist jedoch aufwendig und erfordert Sicherheitsvorkehrungen; auf Kontrastmittel reagieren Patienten teilweise allergisch. Die Methode der britischen Forscher soll deutlich günstiger in der Herstellung und einfacher zu handhaben sein – sie arbeiten mit sogenannten Eisenoxid-Nanopartikeln.
Das sind extrem kleine Teilchen aus Eisenoxid. Die Herstellung erfolgt in der Regel, indem Eisen und Eisensalze in Lösungen mit Basen reagieren. Entscheidend ist, dass die Nanopartikel magnetisierbar sind. Denn darauf wiederum reagieren Diamanten – sie verändern dann ihre Farbe.
Test bei Brustkrebspatientinnen
Getestet haben die Forscher ihr Verfahren bei Patientinnen mit Brustkrebs. Dafür haben sie die Eisenoxid-Nanopartikel vor oder während einer Brustkrebsoperation in den Tumor gespritzt. Von dort "reisen" die Nanopartikel dann über die Lymphbahnen zu den Metastasen. Der Diamanten-Sensor – mit einem gerade einmal 0,5 Kubikmillimeter großen Diamanten – kann die Eisenoxid-Nanopartikel an den betroffenen Lymphknoten dann wieder aufspüren. Denn während gesundes Lymphgewebe die Nanopartikel aufnimmt, tun Metastasen das nicht einheitlich. Das zeigt sich dann bildlich in heller oder dunkler Farbe.
Christoph Alexiou, Oberarzt am Universitätsklinikum Erlangen, arbeitet bereits mit Eisenoxid-Nanopartikeln, um Metastasen zu erkennen. "Eisenoxid-Nanopartikel werden schon seit vielen Jahren verwendet", sagt er. Man müsse jedoch für das Aufspüren der Partikel keinen Diamanten-Sensor nutzen: "Die Detektion funktioniert auch mit MRT oder Ultraschall." Den deutlich kleineren Diamanten-Magnetsensor hält er aber für eine vielversprechende Entwicklung. "Bis zur Zulassung muss aber die klinische Machbarkeit noch gezeigt werden, etwa an Gewebeproben oder mit Tierversuchen", schränkt er ein.
"Bei 96 Prozent der Krebspatienten finden wir sogenannte solide Tumore. Bei ihnen kann die Methode sehr gut zum Einsatz kommen."
Dann aber könnte die Methode vielen Krebspatienten helfen. Ausgenommen seien Patienten solcher Krebsarten, bei denen es keinen örtlich abgegrenzten Tumor gibt oder bei denen dieser nicht gefunden werden kann. "Bei 96 Prozent der Krebspatienten finden wir sogenannte solide Tumore. Bei ihnen kann die Methode sehr gut zum Einsatz kommen", sagt Alexiou. Eine Ausnahme seien zum Beispiel Menschen mit Leukämie, einer systemischen Knochenmarkserkrankung, bei der es keinen lokalen Tumor gibt.
Empfehlungen der Redaktion
Helfen könnte die Methode Patienten vor allem dadurch, dass sie das Ausmaß der Operationen reduziert. "Man kann Patienten unter Umständen ersparen, alle Lymphknoten in der Achselhöhle ausräumen zu müssen. Dann haben sie später weniger Beschwerden", erklärt Alexiou. Und bei Prostatakrebs etwa könne man, wenn man die Metastasen besser orten könne, minimalinvasiver operieren und damit das Risiko für Inkontinenz oder Impotenz reduzieren.
Über den Gesprächspartner
- Prof. Dr. Christoph Alexiou ist Oberarzt an der HNO-Klinik Erlangen, Leiter der Sektion für experimentelle Onkologie und Nanomedizin und hat eine Professur für Nanomedizin inne. Das Uniklinikum Erlangen ist Teil des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF). Dieses bietet ein kostenloses "BürgerTelefonKrebs" (0800 85 100 80) an, bei dem man alle Fragen bezüglich einer Krebserkrankung stellen kann.
Verwendete Quellen
- University of Warwick: The diamonds that could find cancer
- msdmanuals.com: Überblick über das Lymphsystem
- krebsinformationsdienst.de: Metastasen bei Krebs