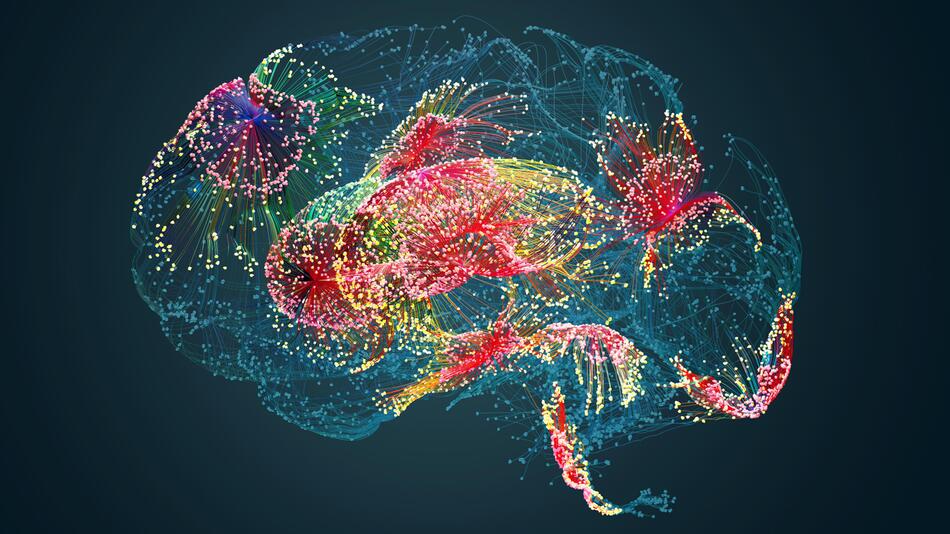Eine Erkrankung an COVID-19 kann langfristig Schäden im Gehirn verursachen. Das zeigt eine aktuelle Studie eines deutschen Forschungsteams. Doch wie verlässlich sind die Ergebnisse?
Bei den gesundheitlichen Folgen von COVID-19 lag der Fokus anfangs auf Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Symptomen. Dabei klagen viele Menschen nach einer Erkrankung auch über anhaltende mentale Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder Vergesslichkeit. Eine aktuelle Studie der SRH University liefert nun erneut Hinweise darauf, dass das Virus tatsächlich Auswirkungen auf das Gehirn haben kann – selbst bei Menschen mit mildem Krankheitsverlauf. Dies betrifft insbesondere die Fähigkeit, zwischen ähnlichen Erinnerungen zu differenzieren.
Gedächtnisfunktion nach COVID-19-Infektion messbar verringert
Ein Forschungsteam am Campus Heidelberg untersuchte in einer Studie, die die Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht hat, den Zusammenhang zwischen einer überstandenen COVID-19-Erkrankung und kognitiven Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Ausführen komplexer Aufgaben sowie Langzeitgedächtnis.
Dazu führten sie verschiedene digitale Tests mit über 1.400 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 90 Jahren durch. Rund zwei Drittel von ihnen gaben an, in der Vergangenheit ein positives Ergebnis eines PCR-Tests erhalten zu haben und damit mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen zu sein. Die restlichen Personen dienten als Kontrollgruppe ohne bisherige Infektion.
Das besondere Augenmerk bei dieser Studie lag auf dem Gedächtnistest Mnemonic Similarity Task. Dieser prüft, wie gut Menschen ähnliche, aber nicht identische Bilder voneinander unterscheiden können – eine Leistung, die auf der sogenannten Mustertrennung im Hippocampus basiert, einem für das Erinnern zentralen Hirnareal. Die Forschenden stellten die Hypothese auf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Corona-Infektion alte Objekte nicht von ähnlichen Bildern unterscheiden könnten.
Das Ergebnis Personen mit überstandener Infektion schnitten beim sogenannten Lure Discrimination Index (LDI), also beim Erkennen ähnlicher, aber neuer Informationen, signifikant schlechter ab als Nicht-Infizierte – auch dann, wenn Alter, Geschlecht, Bildung, depressive Symptome oder Stress als beeinflussende Faktoren berücksichtigt wurden.
Hinweise auf Veränderungen im Hippocampus
Laut den Studienautoren Patric Meyer und Ann-Kathrin Zaiser verschwammen bei den Betroffenen ähnliche Inhalte eher miteinander, neue Inhalte wurden häufiger mit bereits bekannten verwechselt. Diese Defizite könnten auf entzündliche Prozesse im Gehirn, die sogenannte Neuroinflammation, zurückzuführen sein, heißt es.
Frühere Arbeiten hätten gezeigt, dass SARS-CoV-2 eine Neuroinflammation auslösen und dadurch die Bildung neuer Nervenzellen (Neurogenese) im Hippocampus hemmen kann. Hinweise darauf stammen auch aus älteren Studien, in denen bei infizierten Mäusen und verstorbenen COVID-19-Patientinnen und -Patienten eine erhöhte Aktivität der Immunzellen des Gehirns sowie ein Zellabbau im Hippocampus festgestellt wurde.
"Dieser indirekt aus dem Verhalten abgeleitete Befund deutet auf eine beeinträchtigte Neurogenese im Hippocampus nach der Infektion hin, die zu COVID-bedingten Gedächtnisdefiziten beitragen kann", schreiben die Autorin und der Autor in der Studie. Zwar sei diese Funktion in der Untersuchung nicht direkt gemessen worden, man habe jedoch auffällige Verhaltensmuster beobachtet, die auf genau solche Defizite hindeuteten.
Neurologe kritisiert: Studie hat "nur sehr begrenzte Relevanz"
Joseph Claßen, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Leipzig, bewertet die Aussagekraft der Studie gegenüber RiffReporter kritisch "Die Studie hat aus meiner Sicht aus methodischen Gründen nur sehr begrenzte Relevanz. Die Verbindung der aufgezeigten kognitiven Störungen zu COVID-19 ist nicht hinreichend belegt."
Zwar sei der Zusammenhang zwischen Neurogenese, Neuroinflammation und Gedächtnisleistung gut erforscht, jedoch werde keiner der beiden Mechanismen in der Studie explizit untersucht. "Deshalb bleibt ein Zusammenhang spekulativ."
Claßen sieht in der Online-Erhebung weitere methodische Schwächen. Trotz der großen Zahl der Teilnehmenden sei die Studie nicht als repräsentativ anzusehen, urteilt er. "Personen mit neurokognitiven Störungen oder anderen Belastungsfaktoren könnten besonders motiviert gewesen sein, sich an der Studie zu beteiligen", sagt der Neurologe. "Auch ist nicht auszuschließen, dass sich Personen, die vorher von einem Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 beziehungsweise COVID-19 und neuropsychiatrischen Störungen überzeugt waren, überproportional an der Studie beteiligt haben."
Lesen Sie auch
Und Claßen sieht im fehlenden Nachweis von COVID-19-Erkrankungen ebenfalls ein methodisches Problem, da nicht getestete Personen fälschlich als negativ gelten könnten. Eine sichere Zuordnung wäre nur durch Laboruntersuchungen möglich gewesen, sagt der Experte.
Je länger die Infektion zurückliegt, desto größer das Gedächtnisdefizit
Dennoch könnten die Ergebnisse interessante Hinweise auf mögliche Langzeiteffekte liefern. Je mehr Zeit seit dem positiven PCR-Test vergangen war, desto schlechter fiel die Gedächtnisleistung aus. Auch zuvor infizierte Teilnehmende, die angaben, vollständig genesen zu sein, wiesen einen signifikant niedrigeren Gedächtnisindex im Vergleich zu denjenigen ohne Infektionsgeschichte auf.
Zudem steht die Anzahl an überstandenen oder noch bestehenden COVID-Symptomen offenbar in Zusammenhang mit der Schwere der Gedächtnisprobleme. Personen mit mehreren Langzeitsymptomen wie Müdigkeit, Wortfindungsstörungen oder Atemproblemen schnitten ebenfalls schlechter ab.
Andere kognitive Funktionen nicht betroffen
Die Forschenden stellten hingegen keine Unterschiede bei Aufmerksamkeitstests und dem Arbeitsgedächtnis fest. Sie vermuteten, dass die Abweichungen zu früheren Studien, wo man solche Differenzen fand, möglicherweise auf Unterschiede im Schweregrad der Erkrankung bei den Patientinnen und Patienten zurückzuführen seien. Im Gegensatz zu früheren Studien konzentrierte sich diese Untersuchung nämlich vorwiegend auf nicht hospitalisierte Personen.
Laut den Studienautoren stützen sich viele frühere Untersuchungen auf Fragebögen mit subjektiven Selbstauskünften der Patienten. Neuere Untersuchungen verfolgten hingegen andere Ansätze und nutzen direkte experimentelle Tests der kognitiven Funktionen von Patientinnen und Patienten. Der hier angewandte Mnemonic Similarity Task sei besonders geeignet, hippocampus-abhängige Mustertrennungsprozesse zu erfassen.
Gesunde Lebensweise kann Gedächtnisprobleme positiv beeinflussen
Wer nach einer COVID-19-Erkrankung unter Gedächtnisproblemen leidet, kann die Gesundheit des Gehirns laut der Studie gezielt unterstützen – insbesondere durch die Förderung der Neurogenese im Hippocampus. Die Forschenden empfehlen regelmäßige Bewegung, vor allem Ausdauertraining. Denn das fördere das Wachstum neuer Nervenzellen.
Eine ausgewogene Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren, Beeren, Nüssen und grünem Gemüse könne das Gehirn zusätzlich unterstützen. Stressabbau durch Achtsamkeitsübungen oder Yoga, ausreichend Schlaf sowie der gezielte Einsatz bestimmter Medikamente wie Antidepressiva oder Memantin könnten die Regeneration weiter fördern.
Der Neurologe und Klinikdirektor Joseph Claßen stimmt zwar grundsätzlich zu, dass eine gesunde Lebensweise wünschenswert sei. Allerdings sieht er darin keinen Zusammenhang zur Untersuchung der SRH University. "Der Nutzen dieser Verhaltensmodifikationen für den Erhalt oder den Wiedergewinn der beeinträchtigten kognitiven Leistungsfähigkeit ergibt sich nicht aus der vorliegenden Studie."
Forschende fordern mehr Aufmerksamkeit für kognitive Probleme nach COVID-19-Erkrankung
Die Studie gibt zwar Hinweise darauf, dass selbst milde COVID-19-Verläufe mit messbaren Gedächtnisdefiziten einhergehen können – insbesondere im Bereich der Mustertrennung. Sie kann aber letztlich keine Aussagen über die Ursachen dieser Defizite machen. Sie kann lediglich einen Beitrag leisten, die möglichen kognitiven Folgen von COVID-19 besser zu verstehen und könnte sowohl die klinische Praxis unterstützen als auch Ausgangspunkt für künftige Forschungen sein.
Empfehlungen der Redaktion
Die Forschenden sprechen sich dafür aus, ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft für die kognitiven Folgen einer Corona-Infektion zu entwickeln. Dazu gehörten entsprechende Screenings für Menschen mit überstandener COVID-Erkrankung und ein besserer Zugang zu psychiatrischen Diensten. So könne man den Ängsten, dem Stress und möglichen Depressionen der Betroffenen entgegenwirken.
Verwendete Quellen
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
© RiffReporter