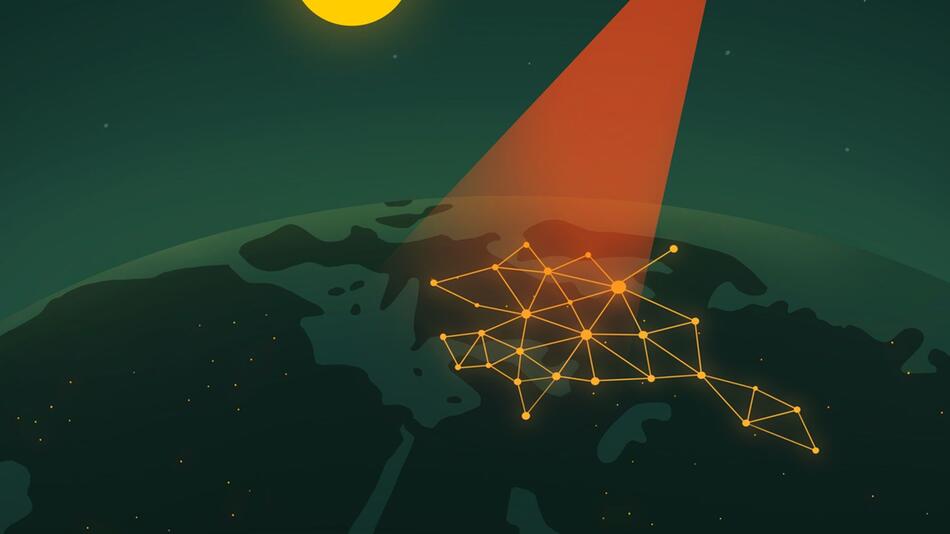Solaranlagen im All könnten laut Studie den Bedarf an Anlagen auf der Erde stark senken. Forscher aus Großbritannien berechnen das Sparpotenzial – sehen aber auch riesige Hürden.
Auf Dächern, Feldern, Balkonen oder auch Gewässern wandeln Solarmodule Sonnenenergie in elektrische Energie um und tragen so dazu bei, einen wachsenden Anteil des weltweiten Energiebedarfs zu decken. Auf der Erde ist der Platz begrenzt, anders als im Weltraum. Wieso also nicht dort Solaranlagen installieren und ausnutzen, dass dort quasi durchgängig Sonnenstrahlung verfügbar ist?
Die US-Weltraumbehörde Nasa und diverse Staaten arbeiten genau an solchen Projekten, die bislang aber noch in den Kinderschuhen stecken. Forscher des King's College London haben nun ausgerechnet, welches Potenzial darin steckt.
Ihr Ergebnis: Solarmodule im Weltraum, wie die Nasa sie bis 2050 in Betrieb zu nehmen plant, könnten den erwarteten Bedarf an Solar- und Windenergieanlagen auf der Erde um rund 80 Prozent verringern. Außerdem könnte sie die Gesamtkosten des europäischen Stromnetzsystems letztendlich deutlich senken – nämlich um 7 bis 15 Prozent, wie aus einer in der Fachzeitschrift "Joule" veröffentlichten Studie hervorgeht. Das entspräche einer Einsparung von rund 35,9 Milliarden Euro pro Jahr. Zunächst muss jedoch viel Geld und Forschung investiert werden.
Großes Potenzial mit großen Herausforderungen
"In der Theorie lassen sich Solarpaneele im All so positionieren, dass sie die Sonne fast ununterbrochen anstrahlt", betont Studienautor Wei He. "Das könnte eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050 spielen", ergänzt er mit Blick auf die europäischen Klimaziele.
Allerdings ist dieses enorme Potenzial mit ebenso großen Herausforderungen verbunden: Es ist davon abhängig, dass die Pläne der Nasa schnell umgesetzt werden, reibungslos funktionieren, weitere technologische Durchbrüche erfolgen und das Ganze deutlich günstiger wird.
Die Idee, Solarmodule im All einzusetzen, stammt bereits aus den 60er Jahren. Lange Zeit galt das Konzept als technisch und wirtschaftlich nicht machbar. Inzwischen forschen jedoch mehrere Länder – darunter China, Indien, Japan, Russland, die USA und Großbritannien – intensiv an der Technologie. Die Paneele würden ähnlich wie Kommunikationssatelliten die Erde umkreisen und optimal an der Sonne ausgerichtet werden. Die gewonnene Energie würde der Studie zufolge in Form von Mikrowellen zu Empfangsstationen auf der Erde übertragen, wo sie dann in Strom umgewandelt und in die bestehende Netzinfrastruktur eingespeist werden könnte.
Zwei verschiedene Ansätze
Derzeit sind einem Nasa-Bericht zufolge zwei verschiedene Designs in der Entwicklung, auf die sich auch die Londoner Forscher beziehen: der "Innovative Heliostat Swarm" und das "Mature Planar Array". Der "Innovative Heliostat Swarm" setzt auf viele kleine Spiegel-Satelliten, die wie ein Schwarm zusammenarbeiten. Jeder einzelne Spiegel fängt Sonnenlicht ein und lenkt es gezielt zu einem zentralen Punkt, wo es gesammelt und in nutzbare Energie umgewandelt werden kann. Der Schwarm-Ansatz macht das System flexibel. Man kann mit einer kleineren Anzahl an Spiegeln beginnen und nach und nach mehr hinzufügen. Die Spiegel lassen sich so ausrichten, dass sie trotz der Bewegungen im All präzise koordiniert arbeiten.
Das "Mature Planar Array" ist ein eher klassischer Ansatz: Hier handelt es sich um große, flache Solarflächen, die im Weltraum ausgerollt werden. Diese Technik ähnelt stark den Solarpaneelen, wie man sie schon von Satelliten kennt, nur in sehr viel größerem Maßstab. Der Vorteil liegt in der ausgereiften Technik, es gibt bereits viel Erfahrung mit ihrem Einsatz im All. Allerdings gestaltet sich der Transport der großen Flächen schwierig und sie sind anfälliger für Schäden.
Der größte Knackpunkt sind die Kosten
Das oben genannte Einsparpotenzial bezieht sich auf die Heliostat-Variante. Doch auch bei dieser müssten die jährlichen Kosten den Autoren zufolge sehr stark sinken, damit die Solarenergie aus dem Weltraum konkurrenzfähig wäre.
Noch ist die Technologie weit von der Marktreife entfernt. "Derzeit liegen die Kosten um ein bis zwei Größenordnungen über den Schwellenwerten, die für einen wirtschaftlichen Einsatz nötig wären", sagte Studienleiter Wei He vom King’s College London.
Die Autoren empfehlen jedoch, gleichzeitig auch auf die etwas weniger effiziente Planar-Variante zu setzen, da sie schneller einsatzbereit sein könne. "Wir empfehlen eine koordinierte Entwicklungsstrategie, die beide Technologien kombiniert und nutzt, um eine bessere Leistung zu erzielen", erklärt He.
Empfehlungen der Redaktion
Es seien noch viel Forschung und weitere Durchbrüche notwendig, bis all das zum Einsatz kommen könne. Dennoch sei es wert, die Designs zu verfolgen, da die Herausforderung der Energiewende enorme Verschiebungen in Richtung erneuerbarer Energien erfordere. (Larissa Schwedes, dpa/bearbeitet von sbi)